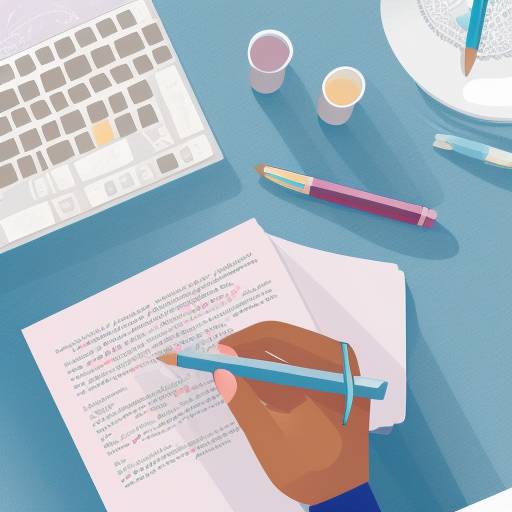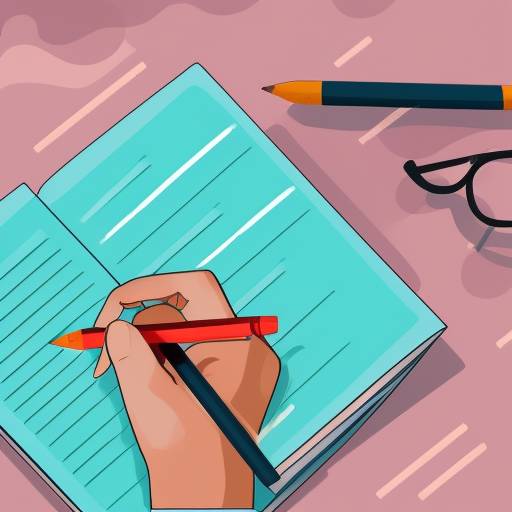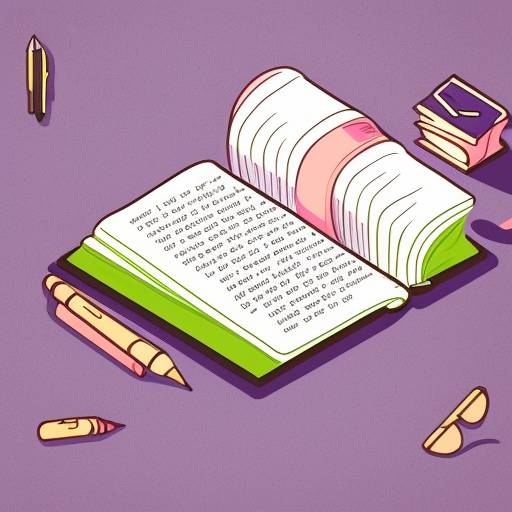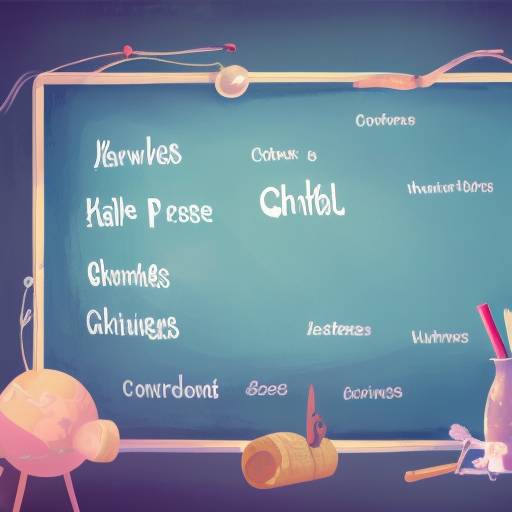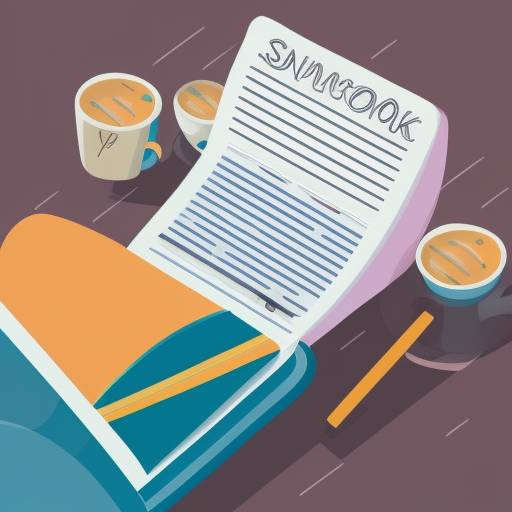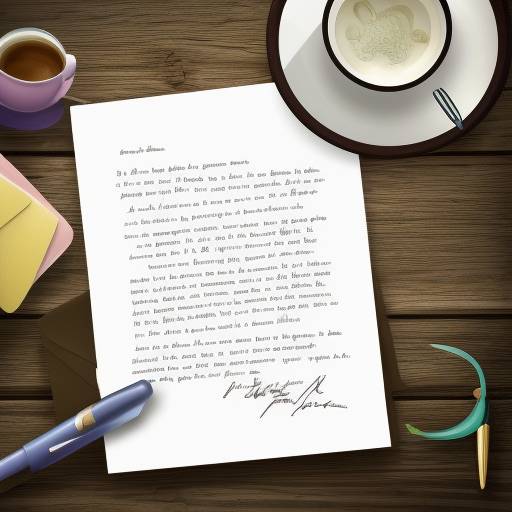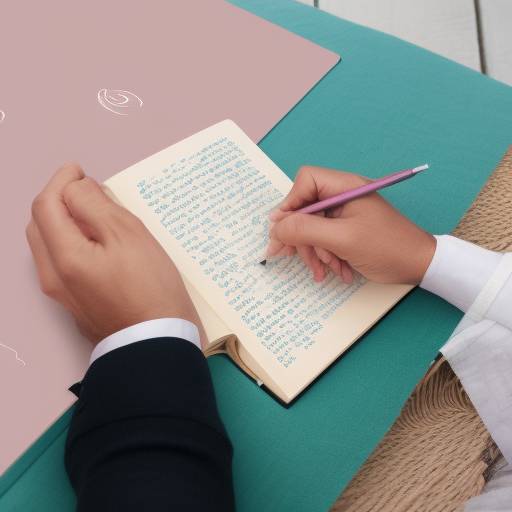Fragen zur Rechtschreibung?
Hier findest du Antworten ... und Menschen, die mitdenken. Du bist unsicher bei einer Schreibweise? Frag nach. Oder hilf anderen mit deinem Wissen.
Was möchtest du wissen?
Erkunde populäre Themen
Aktuell spannende Fragen
Neue Fragen & Antworten
Über uns
Wir begegnen der deutschen Rechtschreibung jeden Tag, in E-Mails, Briefen, Einladungen und vielen kleinen Texten dazwischen. Weil gute Antworten beim Schreiben helfen, sammeln, teilen und diskutieren wir sie gemeinsam.
Wer sind wir?
Wir, das ist das ambitionierte Team von Hello World Digital mit Sitz in Köln, Deutschland. Als Autor:innen sind hier insbesondere aktiv: Julia, Christina, Martin & Sonja.
Warum machen wir das?
Weil Fragen zur Sprache ganz normal sind und gute Antworten den Alltag erleichtern. Weil niemand alles wissen muss und wir gemeinsam bessere Antworten finden, durch Vernetzung und einfachen Austausch im Sinne des ursprünglichen Internet-Gedankens, getragen von echten Menschen, nicht nur von KI.